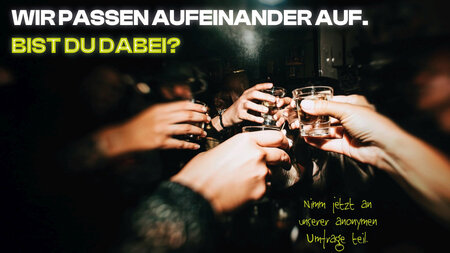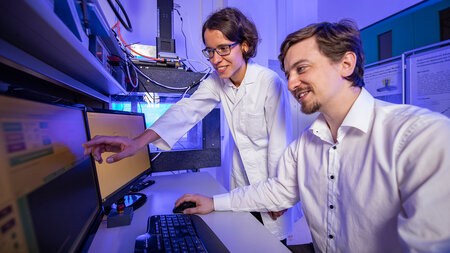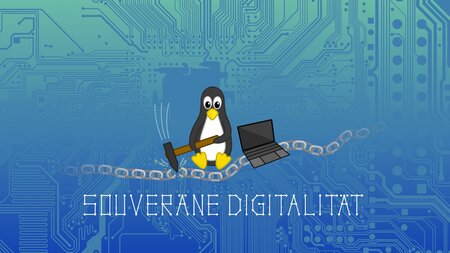Teilprojekt C3
Auslegung der Polarisierungstechnologie für Serienprozesse zur Herstellung adaptiver Strukturkomponenten
Leiter:
Dr. rer. nat. Andreas Schönecker
Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
Winterbergstr. 28
01277 Dresden
Telefon: 0351 / 2553 508
Telefax: 0351 / 2553 136
E-Mail: Andreas.Schoenecker@ikts.fraunhofer.de
Zielsetzung
Zur Erforschung des Werkstoffverhaltens werden geeignete Modellexperimente entwickelt, die anwendungstypische Belastungen nachstellen. Aus den Ergebnissen wird ein Materialmodell für die Bauteilsimulation abgeleitet.
Als Softwarebasis für die Simulation des Polarisierung- und Verformungsverhalten adaptiver Strukturkomponenten dient das FE-Programm CFS++ der Universität Erlangen. Neu ist, dass die Rechnungen ortsaufgelöst und im dreidimensionalen Raum durchgeführt werden. Um akzeptable Rechengeschwindigkeiten zu erreichen sind Optimierungen der Numerik erforderlich.
Die konzipierten methodischen Fortschritte sollen die Beschreibung realer Bauteile erlauben, so dass Empfehlungen für die Bauteilauslegung (Blockierung, Schädigungsrisiken) und die Gestaltung der Serien fertigung (Polarisierung in der Fertigungskette) abgeleitet werden können. Bei ausgewählten Verfahren der Bauteilherstellung wird die Polarisierung direkt in den Herstellungsprozess integriert.
Hauptergebnisse des ersten Bewilligungszeitraums
Innerhalb des Forschungsvorhabens wurden zahlreiche Materialien in Bezug auf Ihr Verhalten unter thermischer als auch mechanischer Last untersucht.
Messungen der ferroelektrischen Hysteresekurve im erweiterten Temperaturbereich von -200 °C bis +175 °C haben gezeigt, dass es ein linearer Zusammenhang zwischen Koerzitivfeldstärke und Temperatur besteht. Daraus leiten sich Parameterbereiche für Temperatur und elektrische Feldstärke, bei denen Domänenwandbewegungen und damit eine Polarisierung möglich ist.
Des Weiteren wurde eine Materialmodell ausgewählt und weiter entwickelt, das zu einer schnellen Konvergenz führt. Es beschreibt sowohl die ferroelektrischen als auch ferroelastischen Materialeigenschaften und weist vom Modellansatz her schon eine thermische Abhängigkeit auf. Die Modellentwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der TU Dresden, IfWW (Kreher / Belov), der Uni Erlangen (Lerch) und der Uni Klagenfurt (Kaltenbacher). Auf dieser Basis konnte eine numerisch effektive Simulationsumgebung in CFS++ mit verbessertem Materialgesetz geschaffen werden. Diese ist in sich geschlossen und erlaubt die Lösung von Fragestellungen zu Bauteilen.
Poster Hauptergebnisse erster Bewilligungszeitraum
Das Forschungsprogramm des zweiten Bewilligungszeitraums umfasst folgende Teilaufgaben:
AP 1 Experimentelle Untersuchung der Polarisierung und Verformung von Piezokeramiken unter Mehrfeldbelastung
|
Die Erforschung der Wechselbeziehungen zwischen Polarisation und Depolarisationsverhalten unter Mehrfeldbelastung wird fortgesetzt. Die Erweiterungen betreffen insbesondere die Messung orthogonaler Vektorkomponenten, die Erweiterung des Temperaturmessbereiches sowie die Erhöhung der Zeitauflösung bis in den µs – Bereich. Auf diese Weise soll ein vertieftes physikalisches Verständnis der Elementarprozesse ferroelektrischer und ferromechanischer Kopplung erzielt werden. Dabei werden zusätzlich zu den kommerziellen PZT Keramiken bleifreie Piezokeramiken des Systems Kaliumnatriumniobat (KNN) mit Texturvariation untersucht. |
AP 2 Modellentwicklung und FE-Simulation der Polarisierung und Verformung von Piezokeramiken in Werkstoffverbunden
| Die experimentellen Ergebnisse des AP 1 werden genutzt, um das Materialmodell zu optimieren und zu verfeinern. Durch Implementierung in die FE – Simulationsumgebung CFS++ wird eine effektive Simulationen von Bauteilen ermöglicht. |
AP 3 Ableitung von Auslegungs- und Fertigungsempfehlungen für die Funktionsoptimierung adaptiver Strukturkomponenten
| Die Erkenntnisse zum spezifischen Materialverhalten der Piezokeramik unter Mehrfeldbelastung aus AP 1 sollen auch für die Erweiterung der Fertigungstoleranzen der im SFB /Transregio betrachteten Fertigungsketten genutzt und für die Einstellung der optimalen Funktionalität angewendet werden. Hierzu werden neben den Modellierungen auch ausgewählte analytische Modelle herangezogen. |
AP 4 Entwicklung der Polarisierungstechnologie für Serienprozesse
| Entsprechend der Einordnung in die Fertigungsketten soll in diesem Arbeitspaket die konkrete Polarisierungstechnologie erarbeitet werden. Technologische Freiheitsgrade ergeben sich aus dem zeitlichen Verlauf der eingespeisten Polarisationsladungen, der Feldstärke, der mechanischen Last und in gewissen Grenzen der Temperatur. |